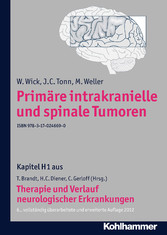
Primäre intrakranielle und spinale Tumoren - H1 Therapie und Verlauf neurologischer Erkrankungen
von: W. Wick, J. C. Tonn, M. Weller, Christian Gerloff, Thomas Brandt, Hans-Christoph Diener
Kohlhammer Verlag, 2013
ISBN: 9783170246690
Sprache: Deutsch
35 Seiten, Download: 1982 KB
Format: EPUB, PDF, auch als Online-Lesen
Mehr zum Inhalt

Primäre intrakranielle und spinale Tumoren - H1 Therapie und Verlauf neurologischer Erkrankungen
[813] H 1 Primäre intrakranielle und spinale Tumoren
von W. Wick, J. C. Tonn und M. Weller
H 1.1 Einleitung
Dieses Kapitel behandelt primäre Tumoren des zentralen und peripheren Nervensystems (ZNS). Primäre ZNS-Lymphome (Kap. H 2), Hirnmetastasen (Kap. H 3) und Meningeosis neoplastica solider Tumoren (Kap. H 4) werden in separaten Kapiteln erörtert. Allgemein gebräuchliche Malignitätskriterien wie infiltratives Wachstum oder Metastasierung werden der klinischen Bedeutung der primären Hirntumoren nur unzureichend gerecht. Auch die malignen primären Hirntumoren metastasieren selten außerhalb des ZNS. Andererseits können auch histologisch benigne Tumoren durch Entstehung eines obstruktiven Hydrozephalus oder Beeinträchtigung der Funktion lebensnotwendiger zerebraler Strukturen erhebliche Morbidität verursachen. Tab. H 1.1 fasst die aktuelle WHO-Klassifikation der Hirntumoren zusammen (Louis et al. 2007).
Die Ätiologie der meisten Hirntumoren ist unbekannt. Selten besteht ein erhöhtes Risiko für bestimmte Hirntumoren aufgrund einer Erbkrankheit (Tab. H 1.2). Für die überwiegende Mehrzahl der Hirntumoren sind genetische Faktoren jedoch nicht relevant. Auch Umweltfaktoren spielen vermutlich nur eine untergeordnete Rolle. Weder für Kopfverletzungen oder bestimmte Ernährungsgewohnheiten noch für den Gebrauch von Mobiltelefonen (Handys) wurde eine Assoziation mit Hirntumoren gezeigt. Letzteres kann auch mit der gegenüber anderer Strahlung geringeren Effektivität und der erst in den letzten 15 Jahren stärkeren Verbreitung zu tun haben. Die Strahlentherapie des Gehirns scheint das Risiko für die Entwicklung von Meningeomen um den Faktor 10 und von Gliomen um den Faktor 3–7 zu erhöhen. Da Hirntumoren in Tiermodellen viral oder chemisch auslösbar sind, könnten solche Faktoren auch beim Menschen relevant sein. Epidemiologische Daten zu Inzidenz, Altersverteilung und Überlebensraten von Patienten mit Hirntumoren aus den USA finden sich in Tab. H 1.3 und Tab. H 1.4.
Das klinische Syndrom bei Hirntumoren wird durch die Lokalisation und die Tumorentität bestimmt. Die Bestätigung der Verdachtsdiagnose erfolgt durch bildgebende Verfahren, in erster Linie Magnetresonanztomographie (MRT), bei Kontraindikationen oder im Einzelfall ergänzend die Computertomographie (CT), mit Kontrastmittelgabe. Die Kontrastmittelaufnahme als Zeichen einer gestörten Blut-Hirn-Schranken-Funktion ist generell mit höherer Malignität assoziiert, aber diese Korrelation ist nicht ausreichend, um auf eine histologische Verifizierung des Malignitätsgrads zu verzichten. [814][815][816][817] So sind 45 % der Gliome ohne Kontrastmittelaufnahme dennoch höhergradig (III/IV) (Kunz et al. 2011), während fast 50 % der niedriggradigeren (I/II) Tumoren Kontrastmittel aufnahmen (Scott et al. 2002).
Die MRT ist außerdem die wichtigste diagnostische Maßnahme für die Beurteilung der Wirksamkeit der Therapie in klinischen Studien (Wen et al. 2010) (Tab. H 1.5). Da jedoch das Ansprechen auf Chemotherapie zumindest bei Gliomen nicht mit der Dauer des progressionsfreien Überlebens korreliert (Grant et al. 1997), gilt das Ansprechen auf eine Therapie nach bildgebenden Kriterien vor allem als geeigneter Parameter zur Bewertung der biologischen Aktivität neuer Substanzen in Phase II-Studien und möglicherweise zur Identifizierung von Patienten, die längerfristig von einer antiangiogenen. Therapie profitieren (Prados et al. 2011). Für Studien der Phase III, die die Wirksamkeit einer neuen Therapie im Vergleich zu der jeweiligen Standardtherapie prüfen, sind je nach Gesamtprognose und Einfluss der untersuchten Therapie auf die Bildgebung (»Steroideffekt«) ohne gleichzeitige Wirkung auf die Tumorgröße das progressionsfreie Überleben oder aber das Gesamtüberleben adäquate Endpunkte.
Die zerebrale Angiographie verliert für neuroonkologische Fragestellungen zunehmend an Bedeutung. Sie dient teilweise noch der Operationsplanung, selten der präoperativen Embolisierung tumorversorgender Gefäße. Die Positronenemissionstomographie (PET), insbesondere unter Einsatz von Aminosäure-Tracern, z. B. Methionin oder Fluoräthyltyrosin (FET), wird zur Identifizierung von Arealen hoher metabolischer Aktivität für die Auswahl des Biopsieortes, für die Verlaufsbeurteilung metabolischer Aktivität, die Differenzierung zwischen Tumorrezidiv und Strahlennekrose und die Festlegung des Zielvolumens für die Strahlentherapie eingesetzt (Grosu et al. 2005, Poepperl et al. 2005, Rachinger et al. 2005, Kunz et al. 2011). Grundsätzlich sollte jeder Hirntumor histologisch untersucht werden. Das Tumorgewebe wird entweder durch Biopsie oder mikrochirurgisch partieller oder kompletter Resektion gewonnen. Die stereotaktische Serienbiopsie hat eine diagnostische Sensitivität von annähernd 100 %. Sie ist das Verfahren der Wahl für Probeentnahmen aus Läsionen in eloquenten kortikalen Arealen, der Zentralregion, dem visuellen Kortex, dem Dienzephalon oder dem Hirnstamm. In Zentren mit hoher Expertise liegen die Raten der permanenten Morbidität unter 3 % und der Letalität unter 1 % (Kreth et al. 2001).
H 1.2 Therapeutische Prinzipien
H 1.2.1 Antiödematöse Behandlung
Das vasogene Ödem ist eine wesentliche Ursache für die klinischen Defizite von Patienten mit Hirntumoren. Maligne Tumoren wie das Glioblastom werden häufiger als histologisch gutartigere Läsionen von einem Ödem begleitet. Lösliche Faktoren wie der vascular endothelial-derived growth factor (VEGF) spielen eine wichtige Rolle bei der Ödembildung. Das als vasogen klassifizierte hirntumorassoziierte Ödem spricht sehr gut auf Kortikosteroide an. Die Behandlung mit Steroiden wie Dexamethason (z. B. Fortecortin®) ist daher integraler Bestandteil der Behandlung bei raumfordernden Hirntumoren. Meist werden 8–16 mg Dexamethason (z. B. Fortecortin®) einmal täglich verabreicht (↑, A). Eine Ausnahme muss bei der Differentialdagnose des primären ZNS-Lymphoms gemacht werden (Kap. H 2), bei dem wegen der Verschleierung der Diagnose vor einer Biopsie auf den präoperativen Einsatz von Steroiden verzichtet werden sollte. Falls keine Operation geplant wird, z. B. bei multiplen Metastasen eines bekannten Primärtumors, reichen zur Palliation gewöhnlich geringere Steroiddosen (Kap. H 3). Hohe intravenöse Dosen (40–100 mg Dexamethason) sind bei drohender Einklemmung oder rascher sensomotorischer Verschlechterung aufgrund eines spinalen Tumors indiziert. Postoperativ sollten die Steroide nach klinischen Kriterien ausgeschlichen werden. Der therapeutische Nutzen der Steroide muss gegenüber den unerwünschten Effekten längerfristiger Behandlung mit Steroiden abgewogen werden. Diese umfassen Immunsuppression, gastrointestinale peptische Ulzera, Osteoporose, Depression, Psychose, Hautveränderungen, Myopathien und erhöhtes Risiko thrombembolischer [818] Ereignisse. Als Regel gilt: so wenig wie möglich, so viel wie nötig. Steroide sollten wegen der möglichen negativen Interaktion mit der Chemotherapie nach Möglichkeit vor deren Beginn reduziert oder ausgeschlichen und nicht als Antiemese eingesetzt werden (Roth et al. 2010).
H 1.2.2 Operation
Operative Eingriffe dienen nicht nur der Gewinnung von Gewebe für die definitive Diagnose, sondern sind für viele Hirntumoren auch die wichtigste therapeutische Maßnahme. Fortschritte in der Bildgebung und neue Entwicklungen in der Chirurgie und der Anästhesie haben die Präzision der Eingriffe verbessert und den durch neurochirurgische Interventionen erzielbaren Überlebensvorteil bei vielen Tumorentitäten deutlich vergrößert. Astrozytome des WHO-Grads I, Meningeome, Akustikusneurinome und Hypophysenadenome gehören zu den operativ heilbaren Tumoren. Für Patienten mit diffus wachsenden oder malignen Astrozytomen ist die Operation hingegen nicht kurativ. Diese Patienten müssen zur Verbesserung der Prognose zusätzlich bestrahlt oder chemotherapiert werden. Da das Volumen des Resttumors bei diesen Tumoren möglicherweise ein prognostischer Faktor ist, verfolgen zahlreiche Strategien, beispielsweise der Einsatz der fluoreszenzgestützten Resektion mit 5-Aminolävulinsäure, das Ziel, eine nach mikrochirurgischen Kriterien komplette Tumorresektionen ohne neurologische Morbidität zu ermöglichen (Stummer et al. 2006). Es gilt als wünschenswert, eine maximale erzielbare Resektion mit dem Funktionserhalt in der Gliomchirurgie zu verbinden, sowohl bei Erstdiagnose als auch beim Rezidiv (Stummer et al. 2011;...
Kategorien
Kategorien
Service
Info/Kontakt









