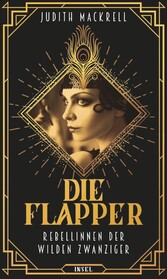
Die Flapper - Rebellinnen der wilden Zwanziger. Mit zahlreichen Abbildungen.
von: Judith Mackrell
Insel Verlag, 2022
ISBN: 9783458773269
Sprache: Deutsch
624 Seiten, Download: 3733 KB
Format: EPUB, auch als Online-Lesen
Vorwort
Am 2. Oktober 1925 stand eine junge amerikanische Tänzerin aus dem Schwarzen Getto von St. Louis auf der Bühne des Théâtre des Champs-Elysées in Paris. Ihre Glieder zitterten nicht nur vor Erschöpfung, sondern auch unter dem Lärm der tobenden Zuschauermenge. Das Publikum kreischte, schrie und trampelte; doch was auf sie erschreckend aggressiv wirkte, war nur die lautstarke Art, mit der Paris seine Stars zu feiern pflegte. Drei Monate zuvor war Josephine Baker noch ein dürres Chorus-Girl gewesen, das von einer bescheidenen Gage und einem ehrgeizigen Traum lebte. Jetzt, mit ihrem neuen Image als dunkel glänzende, exotische Schönheit, wurde sie als kulturelles Phänomen bejubelt.
Der Paris-Korrespondent des New Yorker berichtete, keine halbe Stunde nach Bakers Debüt sei in sämtlichen Bars und Cafés der Stadt nur noch von ihrem ungemein erotischen Tanzstil gesprochen worden. Maurice Bataille, ein Restaurantbesitzer, der später einer ihrer Liebhaber werden sollte, behauptete, Josephines nackte Pobacken (»Quel cul elle a!«) hätten »ganz Paris einen Steifen« verpasst.1 In den folgenden Tagen priesen Künstler wie Kritiker sie als »schwarze Perle«, als »Venus aus Ebenholz«, als »Vamp des Jazz mit der Seele einer afrikanischen Göttin«.
Bald gab es Postkarten von »La Baker« zu kaufen, ebenso eine Reihe von Josephine-Puppen. Ihr glänzend schwarzes Haar und die hellbraune Haut, für die sie zu Hause stets diffamiert worden war, dienten jetzt zur Vermarktung französischer Kosmetikprodukte: Haarpomade zum Gelen von Bubiköpfen und Walnussöl für falsche Sommerbräune.
Ihr drahtiger, gelenkiger Körper galt als Schönheitsideal; er entsprach der Hochglanzästhetik des Art déco und dem knabenhaften Flair der französischen garçonne.
Für einige junge Frauen, die sie tanzen sahen, wurde Josephine gar zum Vorbild für die eigene Verwandlung. In vielen Teilen der westlichen Welt waren die zwanziger Jahre als Jahrzehnt der Veränderung begrüßt worden. Der Erste Weltkrieg mit seinen Millionen Toten, zerstörten Volkswirtschaften und gestürzten Regimen mochte den Optimismus des Jahrhundertbeginns zum Platzen gebracht haben, doch aus der Verheerung heraus erfand sich die moderne Welt mit erstaunlicher Geschwindigkeit neu. Befeuert vom boomenden amerikanischen Aktienmarkt und einer brummenden Konjunktur entwickelten sich die Zwanziger zur Dekade des Massenkonsums und des grenzüberschreitenden Reisens, des Films, des Radios, der knallbunten Cocktails und des Jazz. Und sie bargen das Versprechen von Freiheit.
Vor allem für die Frauen war dieses Versprechen verlockend. Der Krieg hatte ihnen das Wahlrecht beschert, vielen auch die Berufstätigkeit, und die soziale Landkarte neu vermessen. Als Josephine Baker nach Paris kam, bewegte sie sich in einer Kultur und auf einem Markt, wie sie vor 1914 undenkbar gewesen wären. Das Gleiche galt für die polnisch-russische Künstlerin Tamara de Lempicka.
Im zaristischen Russland, wo Tamara behütet aufgewachsen war, bestand ihr Leben aus Vergnügungen und Privilegien. Doch als die Revolution von 1917 dieses Leben in Trümmer legte, sah sie sich gezwungen, mit Mann und Kind ins Exil zu gehen. Gestrandet in einem kleinen Hotelzimmer in Paris, fehlte es ihr schlichtweg an vermarktbaren Fähigkeiten, von einem amateurhaften Maltalent und einem gesunden Selbstvertrauen mal abgesehen. Gegen Ende der 1920er Jahre hatte sie beides erfolgreich dazu genutzt, sich zu einer der angesagtesten Künstlerinnen der neuen Dekade zu stilisieren.
Tamaras berühmteste Bilder stellten junge Frauen dar, deren Körper jene sexuelle Selbstbestimmtheit ausstrahlten, die für den Stil der 1920er Jahre so prägend war wie Josephine Bakers Tanz. Tamara hat ihre Affinität zu Josephine immer betont, auch wenn sie nie den Versuch unternahm, sie zu malen: »Jeder, der sie sah, lechzte nach ihrem Körper. Sie glich aber ohnehin den Figuren auf meinen Bildern, also konnte ich sie schlecht bitten, für mich Modell zu sitzen.«2
Zu Josephines Verehrerinnen gehörte auch die englische Dichterin und reiche Erbin Nancy Cunard. Sie hatte ebenfalls ihrer Heimat den Rücken gekehrt, um sich in Paris niederzulassen, doch obwohl sie dieselben Nachtklubs, Bars und Partys frequentierte wie Tamara, war sie vor allem mit der Pariser Avantgarde vernetzt. In besagtem Herbst war sie gerade dabei, sich aus einer Liaison mit dem Dadaisten Tristan Tzara zu lösen und in Louis Aragon zu verlieben, einen der Begründer des Surrealismus.
Nancy, ein einsames, kleines Mädchen mit einem Faible für Bücher, wurde durch den Widerstand gegen ihre Mutter, eine hemmungslose Gesellschaftslöwin, darin bestärkt, sich in Paris ein eigenes Leben aufzubauen. Acht Jahre später schien die Transformation von der englischen Erbin zur Rive-Gauche-Rebellin perfekt: Nancy trug einen präzisen Kurzhaarschnitt, umrandete ihre Augen mit Kajal, belud sich bis zum Ellenbogen mit Elfenbein- und Ebenholzarmreifen; und zu der langen Liste ihrer Liebhaber zählte ein Schwarzer Jazzpianist aus Georgia.
Ebenfalls Mitte der 1920er Jahre in Paris: Zelda Fitzgerald. Die »schlanke, geschmeidige« Grazie und der »verwöhnte, verführerische Mund« der Südstaatenschönheit aus dem ländlichen Alabama wurden bekanntermaßen zum Vorbild für die modernen Heldinnen in den Romanen ihres Mannes F. Scott Fitzgerald.3 Ihre Jugendfreundin Tallulah Bankhead hatte Zelda immer bewundert und sich selbst als das pummelige, aufsässige hässliche Entlein ihrer eigenen Südstaatenfamilie gefühlt. Doch als Fünfzehnjährige – Tallulah hatte sich inzwischen zu einer Schönheit zurechtgehungert – gewann sie im Wettbewerb einer Illustrierten eine Nebenrolle in einem Film. Das war der Einstieg in eine Karriere am Broadway und im Londoner West End, wo sie 1925 zum Star wurde. Frech, geistreich und atemberaubend hübsch, galt Tallulah bald als die Newcomerin auf den Bühnen Londons.
Nicht weniger fasziniert war das amerikanische Publikum von der very britischen und very aristokratischen Lady Diana Cooper, die Mitte der zwanziger Jahre mit Max Reinhardts Theaterspektakel Das Mirakel durch die Staaten tourte. Als jüngste Tochter des 8. Duke of Rutland stand Diana nur eine Stufe unter den Mitgliedern des Königshauses und war in einem goldenen Käfig aufgewachsen, aus dem sie am Arm eines reichen, blaublütigen Gatten entlassen werden sollte. Als sie sich in einen Mann verliebte, der weder Geld noch Titel besaß, brach sie mit einer jahrhundertealten Tradition. Sie verdiente selbst das Geld, das ihrem Mann später zu einer Karriere in der Politik verhalf, und dies in einem Beruf, mit dem sie eine Generation früher noch gesellschaftliche Ächtung riskiert hätte.
Im Herbst 1925 brachen alle sechs Frauen an Orte auf, die weit entfernt von dem lagen, was sie selbst oder andere sich für sie vorgestellt hatten. Sie taten dies nicht als Gruppe, obgleich sich ihre Wege vielfach kreuzten, doch ihre Reisen standen für einen tiefgreifenden Wandel, der sich in ihrem Umfeld vollzog und die Lebenswege und Erwartungen von Frauen grundlegend verändern sollte.
Die öffentliche Wahrnehmung reagierte auf diese Veränderungen, indem sie dem neuen Frauentyp ein eigenes Etikett verpasste – der vielfach dämonisierte und mythisierte »Flapper« war geboren. Wie Ardita Farnam4, eine von F. Scott Fitzgeralds frühen Heldinnen, schien diese Art von Frau einzig von dem Ziel getrieben, »so zu leben, wie ich will, und auf meine Art zu sterben«. Getragen von der Dynamik des gesellschaftlichen Wandels in den Zwanzigern forderte sie für sich all das ein, was ihrer Mutter versagt geblieben war: von der Wahl ihrer Sexualpartner und dem Verdienen des eigenen Geldes bis zu immer kürzeren Haaren und Röcken und Rauchen in der Öffentlichkeit.
Für Diana Cooper, die älteste Vertreterin der Flapper in diesem Buch, entstand der Impuls, »so zu leben, wie ich will«, aus den qualvollen Erschütterungen der Kriegsjahre. Weil die traditionellen Regeln der Klassengesellschaft aufgehoben waren, fand sie die Kraft, sich ihrer Familie zu widersetzen, zunächst durch den Kriegsdienst als Krankenschwester, später durch die selbstbestimmte Wahl von Ehemann und Karriere. Auch Nancy Cunard diente der Krieg als Sprungbrett in die Rebellion, doch trieb sie ...
Kategorien
Kategorien
Service
Info/Kontakt










