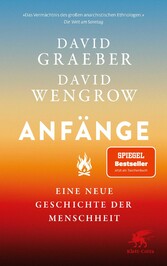
Anfänge - Eine neue Geschichte der Menschheit
von: David Graeber, David Wengrow
Klett-Cotta, 2022
ISBN: 9783608118414
Sprache: Deutsch
672 Seiten, Download: 5600 KB
Format: EPUB, auch als Online-Lesen
Kapitel Eins
Abschied von der Kindheit der Menschheit
Oder warum dies kein Buch über die Ursprünge der Ungleichheit ist
Diese Stimmung macht sich ja überall bemerkbar, politisch, sozial und philosophisch. Wir leben im Kairos für den »Gestaltwandel der Götter«, das heißt der grundlegenden Prinzipien und Symbole.
C. G. Jung, Gegenwart und Zukunft (1957)
Unwiederbringlich ist der größte Teil der Menschheitsgeschichte für uns verloren. Homo sapiens, unsere Spezies, existiert seit mindestens 200 000 Jahren. Für diesen Zeitraum haben wir jedoch größtenteils keine Ahnung, was mit dem Homo sapiens passierte: In der Höhle von Altamira in Nordspanien wurden beispielsweise in einem Zeitraum von mindestens 10 000 Jahren, von etwa 25 000 bis etwa 15 000 v. Chr., Gemälde und Gravuren geschaffen. Vermutlich sind in dieser Zeit eine Menge interessanter Dinge geschehen, wurde eine Vielzahl einzigartiger Objekte zum ersten Mal überhaupt erst geschaffen und hervorgebracht, aber wir haben keine Möglichkeit zu erfahren, um was für Ereignisse es sich bei den meisten von ihnen handelte.
Für sehr viele Menschen hat dies so gut wie keine Bedeutung. Sie denken ohnehin kaum über den Gesamtverlauf der Menschheitsgeschichte nach. Dazu haben sie auch kaum einen Grund. Wenn das Thema überhaupt aufkommt, dann hängt es meistens mit der Frage zusammen: Warum befindet sich die Welt offenbar in einem so miserablen Zustand und warum behandeln Menschen einander so oft schlecht? Das Thema hängt also zusammen mit der Frage nach den Ursachen für Krieg, Gier, Ausbeutung und der systematischen Gleichgültigkeit gegenüber dem Leiden anderer. Waren wir schon immer so? Oder ist an irgendeinem Punkt etwas schrecklich missraten?
Im Grunde genommen ist dies eine theologische Debatte, denn eigentlich geht es um die Frage: Ist der Mensch von Natur aus gut oder böse? So formuliert hat die Frage genau betrachtet jedoch kaum einen Sinn. »Gut« und »böse« sind rein menschliche Konzepte. Niemandem würde es einfallen, darüber zu streiten, ob ein Fisch oder ein Baum gut oder böse ist, denn »gut« und »böse« sind Begriffe, die wir Menschen erfunden haben, um uns miteinander vergleichen zu können. Ein Streit, ob die Menschen dem Wesen nach gut oder böse sind, hat deshalb etwa genauso viel Sinn, wie ein Disput darüber, ob sie im Grunde dick oder dünn sind.
Dennoch kommen Menschen, wenn sie über die Lehren aus der Vorgeschichte nachdenken, fast immer auf solche Fragen zurück. Mit der christlichen Antwort sind wir alle vertraut: Wir lebten einst in einem Zustand der Unschuld, sind jedoch durch die Ursünde verdorben. Wir wollten sein wie Gott und wurden dafür bestraft. Nun leben wir in einem gefallenen Zustand und hoffen auf Erlösung.
Die populäre Version dieser Geschichte ist heute vermutlich irgendeine aktualisierte Fassung von Jean-Jacques Rousseaus 1754 geschriebener Abhandlung über den Ursprung und die Grundlagen der Ungleichheit unter den Menschen. Einst, so heißt es in der Geschichte, waren wir Jäger und Sammler, die in kleinen Gruppen in einem anhaltenden Zustand kindlicher Unschuld lebten. Diese Gruppen waren egalitär, und das war genau deshalb möglich, weil sie so klein waren. Erst mit der »Neolithischen Revolution«, die je nach Region vor 10 000, teilweise schon vor 20 000 Jahren begann, und noch mehr mit dem Aufstieg der Städte ging dieser glückliche Zustand zu Ende und wurde von der »Zivilisation« und »dem Staat« abgelöst. Dies brachte auch Literatur, Wissenschaft und Philosophie hervor, aber zugleich kam auch fast alles Schlechte in die Welt: das Patriarchat, stehende Heere, Massenhinrichtungen und nervige Bürokraten, die von uns verlangen, dass wir den größten Teil unseres Lebens damit verbringen, Formulare auszufüllen.
Das alles ist selbstverständlich ausgesprochen grob vereinfacht, und doch scheint es wirklich die Gründungsgeschichte zu sein, die immer dann an die Oberfläche kommt, wenn irgendjemand, sei es ein Industriepsychologe oder ein Revolutionstheoretiker, beispielsweise behauptet: »Aber natürlich lebte der Mensch für den größten Teil seiner Entwicklungsgeschichte in Gruppen von zehn oder zwanzig Mitgliedern« oder »die Landwirtschaft war vielleicht der größte Fehler der Menschheit«.
Viele populäre Schriftsteller vertreten, wie wir sehen werden, ausdrücklich diese Ansicht. Das Problem ist nur, dass jeder, der nach einer Alternative zu diesem doch recht deprimierenden Geschichtsbild sucht, schnell feststellen wird, die einzig verfügbare ist sogar noch schlimmer: wenn nicht Jean-Jacques Rousseau (1712–1778), dann Thomas Hobbes (1588–1679).
1651 erschien die Erstausgabe des Leviathan von Thomas Hobbes. Dieses Buch ist in vieler Hinsicht der Gründungstext der modernen politischen Theorie. Ihm zufolge sind die Menschen selbstsüchtige Wesen. Deshalb war ihr Leben auch im Urzustand keineswegs unschuldig, sondern »einsam, armselig, scheußlich, tierisch und kurz«. Eigentlich herrschte ein Kriegszustand; jeder kämpfte gegen jeden. Wenn es aus diesem finsteren Urzustand irgendeinen Ausweg gab, so war dieser, wie ein Schüler von Hobbes argumentieren würde, zum größten Teil jenen repressiven Institutionen zu verdanken, über die sich Rousseau beschwerte: Regierungen, Gerichte, Bürokratien und Ordnungskräfte. Auch diese Sicht der Dinge existiert schon sehr lange Zeit. Und es hat seinen Grund, dass die englischen Wörter »politics« (Politik), »polite« (höflich) und »police« (Polizei) so ähnlich klingen; sie alle leiten sich von dem griechischen Wort polis (Stadt) ab. Sein lateinisches Äquivalent ist civitas, dem wir die Wörter »Zivilität«, »zivil« und ein gewisses modernes Vorverständnis von »Zivilisation« verdanken.
Die menschliche Gesellschaft beruht demnach auf der kollektiven Unterdrückung unserer niedrigeren Instinkte; je mehr Menschen an einem Ort leben, umso nötiger wird diese Triebhemmung. Ein heutiger Anhänger von Hobbes würde deshalb argumentieren, wir hätten tatsächlich während des größten Teils unserer Entwicklungsgeschichte in kleinen Gruppen gelebt, die vor allem deshalb zurechtkamen, weil sie ein gemeinsames Interesse am Überleben ihrer Nachkommen hatten (»Elternaufwand« nennen dies Evolutionsbiologen).
Selbst diese Gruppen waren jedoch keineswegs auf Gleichheit gegründet. Vielmehr wurden sie, folgt man dieser Anschauung, immer von irgendeinem »Alpha-Mann« geführt. Hierarchie, Herrschaft und zynisches Eigeninteresse waren demnach schon immer die Grundlage der menschlichen Gesellschaft. Nur haben wir kollektiv gelernt, dass es zu unserem Vorteil ist, wenn wir unseren langfristigen Interessen im Vergleich zu unseren unmittelbaren Instinkten die höhere Priorität einräumen; oder besser noch, Gesetze schaffen, die uns zwingen, unsere negativsten Impulse auf gesellschaftlich nützlichen Gebieten wie der Ökonomie auszuleben und sie sonst überall zu verbieten.
Wie der Leser aus dem Ton unserer Äußerungen schließen dürfte, sind wir nicht gerade begeistert davon, zwischen diesen beiden Alternativen wählen zu müssen. Unsere Einwände lassen sich grob in drei Kategorien einteilen. Um den generellen Verlauf der Menschheitsgeschichte darzustellen, sind sie
-
schlicht und einfach unwahr,
-
mit schlimmen politischen Konsequenzen verbunden und
-
dafür verantwortlich, dass die Vergangenheit langweiliger als nötig erscheint.
Dieses Buch ist ein Versuch, mit der Erzählung einer anderen, hoffnungsvolleren und interessanteren Geschichte zu beginnen. Diese neue Erzählung berücksichtigt die Forschungsergebnisse der vergangenen Jahrzehnte stärker. Dabei geht es teilweise darum, die in Archäologie, Anthropologie und verwandten Fächern angehäuften Zeugnisse zusammenzubringen, die offenbar auf eine völlig neue Darstellung der Entwicklung menschlicher Gesellschaften in den vergangenen 30 000 Jahren hindeuten. Fast all diese Forschungsergebnisse stehen zum vertrauten Narrativ im Gegensatz, aber allzu oft sind die bemerkenswertesten Entdeckungen auf die Arbeit von Spezialisten begrenzt, oder sie wurden abgeleitet, indem man bei wissenschaftlichen Publikationen zwischen den Zeilen las.
Um wenigstens ein Gefühl dafür zu vermitteln, wie...
Kategorien
Kategorien
Service
Info/Kontakt










