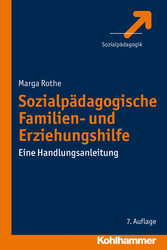
Sozialpädagogische Familien- und Erziehungshilfe - Eine Handlungsanleitung
von: Marga Rothe
Kohlhammer Verlag, 2013
ISBN: 9783170276482
Sprache: Deutsch
116 Seiten, Download: 8407 KB
Format: EPUB, auch als Online-Lesen
2
Wer kann Familien- und Erziehungshilfe leisten?
„Es ist mit einem Humanismus, der nicht über sich selbst hinausweist, wie mit einer abgeschnittenen Blume, man weiß nicht, wie lange sie hält.“ (Golo Mann)
2.1 Anforderungen an die Qualifikation
2.1.1 Berufserfahrene Fachkräfte mit Zusatzqualifikation
(siehe Anhang 1 „Fortbildungsprogramm“)
Hierzu zählen Sozialarbeiter/Sozialpädagogen, Pädagogen, Psychologen und Erzieher mit Erfahrung in der Familien- und Erziehungshilfe. Sie eignen sich bei hoher fachlicher und persönlicher Kompetenz für die Arbeit mit großen Familien, die eine komplexe Problematik aufweisen.
2.1.2 Fachkräfte ohne Zusatzqualifikationen bzw. Berufsanfänger
Diese Mitarbeiter eignen sich besonders für die Arbeit mit jüngeren Familien mit weniger Familienmitgliedern und einer weniger komplexen Problematik bzw. für die Begleitung von allein lebenden Jugendlichen, denen sie Identifikation und Orientierung bieten können. Sie bedürfen in besonderem Maße der intensiven fachlichen Anleitung. Berufsanfänger arbeiten erfahrungsgemäß auch sehr gut in ergänzender Funktion zu einem Familienhelfer im Rahmen von lebenspraktischer Hilfe, Freizeitgestaltung und familienorientierter Schülerhilfe (vgl. dazu Rothe, Familienorientierte Schülerhilfe, 1990).
Sie eignen sich für kreative Angebote in den Familien und für die Gestaltung von Gruppennachmittagen, die insbesondere der Förderung der Gruppenfähigkeit von verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen dienen. Berufsanfänger können nicht alleine arbeiten, sie gehören in ein Familienhelferteam. Hier sollten sie aber mit ihrer häufig optimistischen und kreativen Haltung offene Aufnahme finden. Sie sind in der Regel engagiert, leisten gute Arbeit und sind im Gegensatz zu manch „alten Hasen“ sehr gut in der Lage, die verborgenen Fähigkeiten bei Familien und Jugendlichen unvoreingenommen wahrzunehmen und zu fördern.
2.1.3 Ehrenamtliche Fachkräfte
Ehrenamtliche Fachkräfte sind zumeist Frauen mit länger zurückliegender sozial-orientierter Ausbildung, die sich nach einer Phase der Kindererziehung wieder engagieren, aber nicht vollberuflich tätig sein wollen. Sie verfügen in der Regel über lebenspraktische Erfahrung aus der eigenen Familie und sind in der Lage, ihre früher erworbene fachliche Qualifikation bei entsprechender Fort- und Weiterbildung wieder zu aktivieren. Ehrenamtliche Fachkräfte können wie Berufsanfänger in ergänzender Funktion zu einem Familienhelfer eingesetzt werden. Falls sie die Zusatzqualifikation erwerben, sind sie wie „berufserfahrene Fachkräfte mit Zusatzqualifikation“ im gesamten Bereich der Familien- und Erziehungshilfe einsetzbar und können auch in ein Anstellungsverhältnis übernommen werden.
2.1.4 Ehrenamtliche Laienkräfte
Ehrenamtliche Laienkräfte sind in erster Linie Frauen ohne vorherige sozialorientierte Berufsausbildung, die sich nach der Phase der Kindererziehung sozial betätigen wollen. Ihr Aufgabenschwerpunkt liegt in ergänzenden Funktionen im Rahmen von sozialpädagogischer Lernhilfe, Freizeitgestaltung oder als Bezugsperson für ein Kind, das im Rahmen einer Großfamilie emotional zu kurz kommt. Ehrenamtliche Laienkräfte haben es oftmals schwer, sich in die für sie fremden Lebensbedingungen und Denkstrukturen vieler Familien hineinzuversetzen. Wer dazu bereit ist, ist eine wertvolle Ergänzung im Team der Berufserfahrenen und der Berufsanfänger. Unabdingbar für den Einsatz ehrenamtlicher Laienkräfte ist eine enge Kooperation mit dem zuständigen Familienhelfer und die Bereitschaft, sich über einen längeren Zeitraum für eine bestimmte Aufgabe zuverlässig zu engagieren.
2.2 Anforderungen an die Persönlichkeit
2.2.1 Beziehungsfähigkeit
Der Familienhelfer muss fähig und willens sein, eine Beziehung zur Familie oder zum Jugendlichen einzugehen. Er darf nicht in einer elitären Expertenposition verharren. Er muss sich auf eine Ebene mit der Familie stellen und ihr Anders-Sein im Grundsätzlichen akzeptieren. Das bedeutet auch, dass er sich über die Schwierigkeiten klar werden muss, die diese Andersartigkeit mit sich bringt. Er muss Alkoholproblematik, Schmutz, Lügen, Stehlen, Unzuverlässigkeit etc. als Teil einer sich aus dem Kampf ums Überleben ergebenden Strategie betrachten können. Er ist dazu da, sich auf eine vertrauensvolle Beziehung einzulassen, die es ermöglicht, die dominierende Frage „Was haben wir vom Leben zu erwarten?“ umzukehren in die Frage „Was erwartet das Leben von uns?“ (vgl. V.E. Frankl).
Das Leben erwartet von Eltern, den Kindern eine Zukunft zu geben, ihnen ein normgerechtes Verhalten vorzuleben, ihnen die Grundlage für eine Ausbildung zu ermöglichen, Vorbild zu sein in Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit etc. Diese erwarteten Verhaltensweisen stehen häufig im Gegensatz zu den tatsächlichen Verhaltensweisen der Eltern. Nur auf der Grundlage einer guten Beziehung kann der Familienhelfer vorsichtig unangemessenes Verhalten in Frage stellen. An den Fähigkeiten einzelner Familienmitglieder anknüpfend sind dann am ehesten durch die Erarbeitung eines Selbsthilfeplans Veränderungen möglich. In den Fällen, in denen Eltern zu einer Mitarbeit noch nicht in der Lage oder noch nicht gewillt sind, muss der Familienhelfer zumindest mit ihnen ein vorübergehendes „Stillhalteabkommen“ schließen. Gegen den aktiven Willen der Eltern ist Familienhilfe nicht sinnvoll. Dann sind für die Kinder Hilfen außerhalb des Elternhauses angezeigt.
Es muss ein Ziel des Familienhelfers sein, von der Familie auch als Person angenommen zu werden. Er darf aber nicht Teil des Familiensystems werden, weil er so die notwendige Öffnung der Familie nicht mehr bewirken kann. Er erkennt dann nicht mehr klar genug den Sog der Familie, der Kinder und Jugendliche häufig daran hindert, das unmittelbare vertraute Umfeld der Familie zu überschreiten und sich in Schule, Ausbildungsstelle und Vereinen frei zu bewegen. Der Familienhelfer ist Wegbegleiter in die oft als feindlich erlebte Außenwelt, in der unbekannte Kommunikationsregeln gelten, die Eltern, Kinder und Jugendliche ängstigen. Er vermittelt und hilft, Fluchttendenzen zu reduzieren, die regelmäßig dann entstehen, wenn die Familienmitglieder ihrer andersartigen Verhaltensweisen wegen auf Ablehnung stoßen.
Viele der Eltern trauen sich z.B. nicht mehr, an Schul- oder Konfirmanden-Elterntreffen teilzunehmen, weil sie dort ihrer anderen Sprache und ihres anderen Verhaltens wegen nicht geachtet und beachtet werden. Das Fernbleiben wird oft als Desinteresse ausgelegt. In Wirklichkeit steckt dahinter eine tiefsitzende Angst, abgelehnt zu werden. Sie wird von den Eltern auf die Kinder übertragen und ist häufig der Auslöser für aggressive Handlungen. Der Familienhelfer kann und muss durch eine gute, vertrauensvolle Beziehung zur Familie die Kluft überwinden helfen.
2.2.2 Vorbild und Identifikation: Lernen am Modell
„In der Erziehung hat man wenig zu tun, viel zu lassen, am meisten aber zu sein.“ (Sprichwort)
Der Familienhelfer, der es schafft, eine Beziehung zur Familie herzustellen, wird – ob er will oder nicht – zum Vorbild für die Kinder und Jugendlichen, zum Teil auch für die Eltern. Mit ihm identifizieren und an ihm orientieren sich besonders die Familienmitglieder, die ihn mögen. Familienhelfer, die neben ihrem Beruf wenig eigene Interessen haben, klammern sich oft an die Familien. Für sie ist die Gefahr, Teil des Systems zu werden, besonders groß. Die Familien aber brauchen eine Außenorientierung, um ihre in der Regel als negativ erlebte Isolation zu überwinden. Besonders Kinder und Jugendliche aus „unvollständigen“ Familien, bei denen ein Elternteil faktisch oder erzieherisch-emotional ausfällt, suchen häufig – beginnend mit der Vorpubertät – nach einem gleichgeschlechtlichen Identifikationspartner, an dessen Verhalten sie sich orientieren können. Sie kopieren sein Äußeres, sein Verhalten und seine Einstellung. Damit ist ein hoher Anspruch an den Familienhelfer gestellt.
„Erziehung ist Vorbild und Liebe, weiter nichts“ (Pestalozzi). Das gilt auch für die Familienhilfe. Für Eltern und besonders für Erzieher, die mit Kindern zusammenleben, ist die schwerste Aufgabe, die sich ihnen stellt, rund um die Uhr Vorbild zu sein. Eltern, die nach dem Motto zu erziehen versuchen: „Tu nicht das, was ich tue – tue das, was ich sage“, werden bald erfahren, dass die Kinder ihre Handlungen nachmachen und nicht ihren Worten folgen. Das gilt auch für den Familienhelfer.
Viele Kinder und Jugendliche wollen stolz sein auf „ihren“ Familienhelfer. Oft fragen sie: Darf ich sagen, Du wärst meine große Schwester, mein großer Bruder oder gar meine Mutter? Erfahrungsgemäß legen die Kinder und Jugendlichen, aber auch die Erwachsenen sehr viel Wert darauf, dass der Familienhelfer gepflegt und „schick“ ist. Sie fühlen sich dadurch im eigenen Wert gehoben und streben seinem Vorbild nach.
Ein 14-jähriges Mädchen weigerte sich, mit einem Erziehungshelfer in die Stadt zu gehen, weil er einen Riss in der Jeans-Hose hatte.
Ein 16-jähriger Junge bat eine Familienhelferin, sich für einen Stadtbummel, den er sich zum Geburtstag gewünscht hatte, besonders „schick“ zu machen.
Niemals aber sollte der Familienhelfer Vorbild mit erhobenem Zeigefinger sein! Kein Mensch lässt sich gerne schulmeistern.
2.2.3 Geduld und Zuverlässigkeit
Die...
Kategorien
Kategorien
Service
Info/Kontakt










