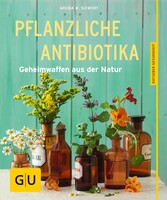
Pflanzliche Antibiotika - Geheimwaffen aus der Natur
von: Aruna M. Siewert
GRÄFE UND UNZER, 2013
ISBN: 9783833837449
Sprache: Deutsch
128 Seiten, Download: 9948 KB
Format: EPUB, auch als Online-Lesen
PFLANZLICHE ANTIBIOTIKA
WAS SIE DAMIT ERREICHEN KÖNNEN:
- Die Heilung bei Infekten fördern.
- Schädliche Bakterien, aber auch Viren und Pilze nebenwirkungsfrei bekämpfen.
- Allgemein an Wohlbefinden gewinnen.
- Das Immunsystem nachhaltig stärken.
- Die Entgiftung des Körpers unterstützen.
- Viele Mineralien und Vitamine aufnehmen.
- Die Wundheilung verbessern.
- Die Wirksamkeit chemischer Antibiotika unterstützen, ihre Nebenwirkungen ausgleichen.
Aruna Meike Siewert
ist Heilpraktikerin und Dozentin an einer Heilpraktikerschule in Berlin
»Gott schläft im Stein, atmet in der Pflanze, träumt im Tier und erwacht im Menschen.«
(Angelus Silesius)
Die Kräfte der Pflanzen
Überall um uns herum lauern Krankheitserreger – unser Immunsystem hat alle Hände voll damit zu tun, ihnen zu trotzen. Wenn es uns »erwischt« hat und wir mit einer Infektionskrankheit kämpfen, greifen wir schnell zum chemischen Antibiotikum. Doch viel seltener als oft gedacht ist dies sinnvoll. Die Medikamente schwächen das Immunsystem und bergen das Risiko, dass die Erreger resistent werden. In diesem Buch lesen Sie, was Antibiotika sind und wie sie wirken. Außerdem erfahren Sie, welche Fragen Sie beim Arzt stellen sollten, wenn er ein Antibiotikum empfiehlt. Ein Extra-Kapitel zeigt Ihnen, wie Sie nach einer nötigen Antibiotikabehandlung mithilfe von Heilpflanzen und gesunder Ernährung Ihr Immunsystem wieder aufbauen.
Der Hauptteil des Buches widmet sich den Kräften altbewährter Heilpflanzen und zeigt Ihnen, wie Sie leichtere Infekte mit pflanzlicher Hilfe ohne Nebenwirkungen behandeln können. Pflanzliche Mittel wirken dabei – im Gegensatz zu chemischen Antibiotika – nicht nur gegen Bakterien, sondern auch gegen Viren und Pilze. Mit antibiotisch wirksamen Heilpflanzen unterstützen Sie Ihr Immunsystem, statt es zusätzlich zu schwächen, und gehen aus jedem Infekt gestärkt hervor. Auf diese Weise sind Sie beim nächsten Infekt gewappnet. Sie werden schneller wieder gesund und seltener krank.
Dieses Buch hilft Ihnen auch dabei, zu erkennen, wann Sie zum Arzt gehen sollten, um Komplikationen zu vermeiden. Ich will Sie jedoch grundsätzlich ermutigen, den Pflanzen und den Selbstheilungskräften Ihres Körpers zu vertrauen! Je mehr Erfahrung Sie damit gewinnen, umso wirkungsvoller können Sie sich und Ihrer Familie selbst helfen.
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Nachschlagen und Lesen – und viel Gesundheit!
Was sind Antibiotika?
Seit wann gibt es eigentlich Antibiotika, wer hat sie entdeckt? Wie wirken sie, wann brauchen wir sie, und was müssen wir bei der Anwendung beachten? Das alles lesen Sie in diesem Kapitel.
Eine Erfolgsgeschichte
Wahrscheinlich haben auch Sie schon einmal oder mehrmals vom Arzt ein Antibiotikum verschrieben bekommen. Hier lesen Sie, was es mit diesen Mitteln auf sich hat.
Alles begann mit einem Pilz
Wie bei vielen Medikamenten gilt für Antibiotika: Was unser Leben retten kann, nützt uns das andere Mal wenig oder schadet sogar.
Aber beginnen wir am Anfang: Der Name Antibiotikum setzt sich zusammen aus dem griechischem »anti«, was so viel wie »gegen« oder »anstelle« bedeutet, und »bios«, also »Leben«. Die Mittel sollen also Lebewesen bekämpfen, welche dem Körper schaden können. Die Geschichte der Antibiotika beginnt weit vor der Zeit des Bakteriologen Alexander Fleming (1881–1955), der allgemein als ihr Entdecker gilt.
Bereits im Jahr 1893 isolierte der italienische Arzt und Mikrobiologe Bartolomeo Gosio (1863–1944) einen Stoff aus einem Schimmelpilz, der den Erreger für die gefürchtete Infektionskrankheit Milzbrand am Wachstum hindern konnte.
Einige Jahre später wunderte sich der französische Militärarzt Ernest Duchesne (1874–1912) darüber, dass die Pferdesättel des Militärs mit Absicht in dunklen, feuchten Räumen aufbewahrt wurden, wo sich Schimmelpilze auf den Sätteln bildeten. Die Begründung der Stallburschen für diese besondere Aufbewahrungsart ließ ihn aufhorchen: Die Scheuerwunden der Soldaten, die durch das Reiten hervorgerufen wurden, würden durch die von Schimmelpilz befallenen Sättel besser abheilen!
Erste wissenschaftliche Versuche
Duchesne begann nun, diese Erkenntnisse in seine Forschung zu integrieren, und bereitete eine Lösung aus Schimmelpilzen zu, die er kranken Versuchstieren injizierte. Die Tiere gesundeten. 1897 schrieb Durchesne seine Doktorarbeit über die antimikrobielle Wirkung von Schimmelpilzen. Vielleicht war er mit seinen gerade 23 Jahren zu jung, vielleicht war er einfach seiner Zeit zu weit voraus, auf jeden Fall wurde die Doktorarbeit damals abgelehnt. Es dauerte noch eine ganze Zeit, bis das Wissen um die bakterienzerstörende Wirkung des Schimmelpilzes anerkannt wurde.
Penicillin: eine Zufallsentdeckung
1921 isolierte der schottische Bakteriologe Alexander Fleming (1881–1955) in seinem Labor ein Lysozym – so nannte er das Enzym, das in der Lage ist, die Zellwände von krank machenden Bakterien zu zerstören und somit das Bakterium abzutöten. Dieses Enzym kommt natürlicherweise in unseren Körperflüssigkeiten vor, besonders in den Schleimhäuten, somit in Tränen, Speichel und so weiter. Es unterstützt unser körpereigenes Immunsystem dabei, Krankheitskeime zu bekämpfen, sofern diese nicht zu gehäuft auftreten.
1928 entdeckte Fleming eher zufällig einen Pilz, der in der Lage war, Staphylokokken aufzulösen – gefährliche Bakterien, die bis heute für zahlreiche schwere Erkrankungen verantwortlich sind. In einer in Vergessenheit geratenen Petrischale mit den Krankheitserregern hatte sich – wahrscheinlich aus einer hygienischen Unachtsamkeit heraus – ein Schimmelpilz gebildet. Fleming erkannte, dass dieser Pilz offensichtlich in der Lage war, die Staphylokokken aufzulösen. Der Pilz heißt Penicillium chrysogenum (früher P. notatum). Alexander Fleming isolierte erfolgreich den keimtötenden Stoff aus dem Pilz – das Penicillin war geboren!
Ohne die Gründe der Heilwirkung benennen zu können, hatten also bereits Duchesnes Stallburschen (siehe links) mithilfe antibiotisch wirkender Substanzen krank machende Bakterien erfolgreich bekämpft!
So ging es weiter
Nicht immer gelang es, mit dem neuen Wirkstoff die Keime abzutöten. Damals war es noch nicht möglich, eine Substanz mit den Eigenschaften des Penicillins chemisch herzustellen. Man brauchte die Pilze und musste daraus immer erst die bakterientötende Substanz isolieren. Deshalb konnte der Einsatz des antibiotischen Stoffes in größeren Mengen beim Menschen noch nicht erfolgen. Im Anschluss an Flemings Entdeckung bedurfte es daher vieler weiterer Forschungen und Bemühungen von Bakteriologen wie Gerhard Johannes Paul Domagk (1895–1964), Biochemikern wie Sir Ernst Boris Chain (1906–1979) und Pathologen wie Howard Walter Florey (1898–1968), bis es 1942 endlich so weit war: Mitten im Zweiten Weltkrieg konnte Penicillin erstmals beim Menschen in größeren Mengen heilbringend eingesetzt werden. Mit dem großflächigen Einsatz von Antibiotika konnte bei schwer verwundeten Soldaten den drohenden Infektionen entgegengewirkt und somit viele Leben gerettet werden.
Später wurde das »Wundermittel« auch in der Zivilbevölkerung eingesetzt. Wirksam bekämpfte man damit bis dahin oft tödlich verlaufende Infektionserkrankungen wie Wundinfektionen, Blutvergiftung, Lungenentzündung, Gehirnhautentzündung, Tuberkulose und andere.
Alexander Fleming entdeckte das Penicillin, das er aus einem Schimmelpilz gewann, durch Zufall in seinem Labor.
ämter und würden
Ein beispielloser Siegeszug der Wissenschaft über die Bakterien hatte durch einen Zufall seinen Anfang genommen. Alexander Fleming wurde für seine Entdeckung geadelt, war Ehrendoktor an verschiedenen Universitäten in Europa und Amerika. 1945 erhielt er zusammen mit Howard Walter Florey und Ernst Boris Chain (siehe oben) den Nobelpreis für Medizin.
Das Wirkprinzip der Antibiotika
Der Einsatz von Antibiotika im Zweiten Weltkrieg siehe > zeigte es erstmals: Sie können bei schweren bakteriellen Erkrankungen lebensrettend sein. Die Entdeckung des Penicillins und die Entwicklung der weiteren antibiotischen Substanzen bedeuteten einen Siegeszug der Medizin gegen viele lebensgefährliche Krankheiten und Epidemien. Erkrankungen, die früher in den meisten Fällen tödlich verliefen, heilen heute mithilfe von Antibiotika oft komplikationslos siehe >.
Erreger töten, Körperzellen...
Kategorien
Kategorien
Service
Info/Kontakt










