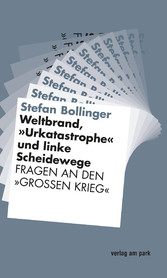
Weltbrand, 'Urkatastrophe' und linke Scheidewege - Fragen an den 'Großen Krieg'
von: Stefan Bollinger
Verlag am Park, 2014
ISBN: 9783897933149
Sprache: Deutsch
224 Seiten, Download: 838 KB
Format: EPUB, auch als Online-Lesen
1. Warum erinnert wird und worüber zu streiten wäre
Geschichtspolitik nach dem Ende des Realsozialismus
2014 erreicht die Geschichtsklitterei einen neuen Höhepunkt: 100 Jahre seit Beginn des Ersten Weltkriegs, der »Urkatastrophe« des kurzen 20. Jahrhunderts. Im ersten Heft des neuen Jahres 2014 verspricht das Nachrichtenmagazin Spiegel: »Der Erste Weltkrieg wird […] zum Mega-Thema der öffentlichen Gedenkkultur werden.« Ja, die Zeitschriftenmacher sind sich sicher, »es wird das bislang größte mediale Geschichtsereignis des 21. Jahrhunderts werden«.
Dabei geht es nicht nur oder vielleicht am allerwenigstens um die Deutungen der Kriegsereignisse und ihrer unmittelbaren Vorgeschichte, sondern um das umfassende Neuschreiben der Geschichte des 20. und damit auch des 21. Jahrhunderts. Der genannte Spiegel-Artikel von Klaus Wiegrefe begeistert sich an dieser Infragestellung, »die eine Debatte wieder aufflammen lassen, die längst entschieden schien. In den 60er Jahren hatte der Hamburger Historiker Fritz Fischer die Bundesrepublik erschüttert wie kein Historiker vor oder nach ihm. Fischer behauptete, Berlins ›Griff nach der Weltmacht‹ sei die Haupt-, wenn nicht sogar alleinige Ursache des großen Sterbens gewesen. Und nach einem hitzigen Streit unter Kollegen setzte sich seine Ansicht im Grundsatz durch. Doch pünktlich zum Jahrhundertgedenken stellen neue Forschungen dieses Bild nachhaltig in Frage.«
Einmal abgesehen davon, dass Fischer keineswegs die Mitverantwortung der anderen Großmächte ausklammerte, bewegt in dieser vermeintlich neuen Sicht allein die mehr oder minder offen ausgesprochene Tatsache, dass neben den Deutschen eben auch die anderen Mächte ihren Beitrag zum Kriegs»ausbruch« leisteten und sich eine vernünftige Krisenpolitik nicht ergab. Deutschlands Schuld wird kleingeredet. Der nun zumindest in der BRD vorherrschende Diskurs stellt heraus, dass es letztlich ein fatales Scheitern einer ach so wohl ausgeglichenen (europäisch dominierten) Weltordnung war. In diesen großen Kladderadatsch seien die damaligen Akteure schlafwandlerisch hineingeschlittert, was dann über 17 Millionen Menschen das Leben kostete und die europäische wie die Weltkarte nachhaltig veränderte. Allein die internationale Staatengemeinschaft, gemeint die von Bonn hegemonierte Europäische Union und vielleicht die USA als verbliebene Großmacht, könnten eine Wiederholung solcher Betriebsstörungen des Kapitalismus vermeiden (und nebenher die sozialen und politischen Konflikte durch das Aufbegehren einer radikalen Linken).
Dieses Umschreiben der Geschichte hat Methode und soll lückenlos sein. Verorteten einst Marxisten-Leninisten in der Oktoberrevolution einen Epochenanfang, dem nachhaltigsten und gewaltsamstem Ausbruch aus dem Ersten Weltkrieg – was unter je eigenen Vorzeichen als Beginn eines Weltbürgerkriegs bis in die Rechte hinein akzeptiert wurde –, so wird nun die »große Unübersichtlichkeit« der jüngeren Vergangenheit und Gegenwart weit in die Vergangenheit transferiert. Zugleich wird Eric Hobsbawms Diktum vom »Zeitalter der Extreme« in diesem ideologischen Kampf um Geschichtsdeutung und Sicherung der heutigen kapitalistischen Politik verfälscht: Es sei ja eine von linken wie rechten Totalitarismen geprägte Zeit, die erst mit der assistierten »Selbstbefreiung« des Ostblocks 1989/91 glücklich zu Ende ging.
Das Jubel- und Erinnerungsjahr 2014 wird zur glücklichen Fügung, in der die Jahrestage von 1914, 1939 und 1989, dazu noch 2004 (EU-Osterweiterung) zusammenfließen. Die »Stiftung Aufarbeitung der SED-Diktatur« konnte so das Konzept dieser Erinnerungspolitik rechtzeitig festschreiben: »2014 lässt sich somit aufzeigen, wie die Geschichte von Demokratie und Diktatur im Europa des 20. Jahrhunderts miteinander verflochten sind. Der Blick auf die europäische Zeitgeschichte vermag das Verständnis dafür zu schärfen, dass die ökonomischen Probleme der europäischen Gegenwart vor dem Hintergrund der unseligen gemeinsamen Vergangenheit lösbar sind und gemeinsam gelöst werden müssen […]. Eine Perspektive auf die europäische Zeitgeschichte, die die Jahre 1914/1939/1989 verbindet, kann dazu beitragen, die europäische Erinnerungskultur zusammen zu führen, in der die Teilung Europas vor 1989 bis heute fortbesteht.«2
Die Stiftung scheut keine Kosten und Mühen, das Jahr 2014 mit einer Wanderausstellung und reichlichem Druckmaterial zu begleiten. Gemeinsam mit dem Münchener Institut für Zeitgeschichte wird in einem Werbeflyer versprochen zu »zeigen, wie die ›Urkatastrophe‹ des 1. Weltkriegs mit ihrer Gewalterfahrung den Aufstieg der totalitären Bewegungen im 20. Jahrhundert begünstigt« habe. Letztlich erzählt die Ausstellung Diktatur und Demokratie im Zeitalter der Extreme »Europas 20. Jahrhundert als dramatische Geschichte zwischen Freiheit und Tyrannei, zwischen Demokratie und Diktatur«. Folgerichtig zeigt der Flyer nicht die Hekatomben von Toten vor Verdun, sondern einen triumphierenden Jugendlichen auf den Berliner Mauerresten 1989.
Wenn so konstruiert wird, dann sind Fragen und Widerspruch notwendig. Ein so definierter Weg zum Triumph der Demokratie muss kritisch unter die Lupe genommen werden. Denn sie ist in dieser Lesart die Antwort auf die totalitären Bewegungen und Diktaturen des 20. Jahrhunderts, von Stalinismus und Faschismus, die zur noch präziseren Diffamierung als Kommunismus und National-Sozialismus gelesen werden sollen. Was interessiert da, dass die Linke am Vorabend des Großen Krieges fast durchweg ihre revolutionären Ansprüche nur noch zu Feiertagen herausholte und ansonsten auf einen evolutionären Wandel ihrer Gesellschaften setzte? Was interessiert der Nationalismus und Militarismus in allen vorgeblich in den Krieg schlitternden Mächten? Warum sollte sich eine solche Geschichtsaufarbeitung mit den vor-faschistischen Ideen, Aktionen und Politiken rechter Bewegungen und rechter Politiker in all diesen Ländern und zuvörderst im Deutschen Kaiserreich beschäftigen? Warum sollte es eine Auseinandersetzung mit der Demokratie der besitzenden Klassen geben, die nur mühsam auch die Masse der Bevölkerung, die Arbeiter und Landarbeiter und ihre linken Organisationen in das parlamentarische Geschäft einbezog? Was interessiert hier, dass die Linken erst in Reaktion auf den Massenmord des Krieges und der gegen sie gerichteten Repressionen jene Radikalität gewannen, die sie zum gewaltsamen Beendigen des Krieges befähigte – zumindest in Russland?!
Im offiziellen Geschichtsdiskurs ist das Erinnern und (Neu-)Bewerten des ersten großen Krieges des 20. Jahrhunderts zentral. Aber auch dies dient nur dazu, nahtlos zur Erinnerung an den folgenden Weltkrieg Nummer Zwei als Revanche-Krieg des Verlierers überzugehen. Letzterer wird dabei als ein Krieg beschrieben, der von zwei Paria der Weltgemeinschaft, von Hitlers Deutschland im Bündnis mit Stalins Sowjetunion verursacht wurde – gegen die Demokratien Europas. Beide Diktatoren werden als Produkt dieser Urkatastrophe deklariert. Nicht untypisch, wenn auch etwas grotesk ist das anekdotenhafte Beschreiben einer fiktiven Begegnung des Bildermalers Adolf Hitler und des Berufsrevolutionärs Josef Stalin im Park des Wiener Schlosses Schönbrunn. »Stalin geht durch den Park, denkt nach, es dämmert schon. Da kommt ihm ein anderer Spaziergänger entgegen, 23 Jahre alt, ein gescheiterter Maler, dem die Akademie die Aufnahme verweigerte und der nun die Zeit totschlägt im Männerwohnheim […]. Er wartet, wie Stalin, auf seine große Chance. Sein Name ist Adolf Hitler. Vielleicht haben sich die beiden, von denen ihre Bekannten aus dieser Zeit erzählten, dass sie beide gerne im Park von Schönbrunn spazieren gingen, einmal höflich gegrüßt und den Hut gelüpft, als sie ihre Bahnen zogen durch den unendlichen Park.
Das Zeitalter der Extreme, das schreckliche kurze 20. Jahrhundert, beginnt an einem Januarnachmittag des Jahres 1913 in Wien. Der Rest ist Schweigen.«3
Dank des hochgelobten Bestseller-Autor Florian Illies wird die sonst noch heile, obschon fragile Welt des Jahres 1913 zum Panoptikum glücklicher wie unglücklicher Intellektueller am Ende der Belle Époque, wird die totalitarismusschwangere, natürlich unbelegte Begegnung der künftigen Diktatoren zur ernst gemeinten Farce. So lieferte auch das Feuilleton zeit- und termingerecht das Gewünschte.
Vergessen, verdrängt und verleugnet sind die Einsichten klügerer Zeitgenossen. Stefan Zweig etwa, der österreichische Schriftsteller und oftmalige Geschichtschronist, kommentierte in der Rückschau im Exil diese Zeit völlig anders: »Wenn ich versuche, für die Zeit vor dem Ersten Weltkriege, in der ich aufgewachsen bin, eine handliche Formel zu finden, so hoffe ich am prägnantesten zu sein, wenn ich sage: es war das goldene Zeitalter der Sicherheit. Alles in unserer fast tausendjährigen österreichischen Monarchie schien auf Dauer gegründet und der Staat selbst der oberste Garant dieser Beständigkeit. Die Rechte, die er seinen Bürgern gewährte, waren verbrieft vom Parlament, der frei gewählten Vertretung des Volkes, und jede Pflicht genau begrenzt. Unsere Währung, die österreichische Krone, lief in blanken Goldstücken um und verbürgte damit ihre Unwandelbarkeit. Jeder wusste, wieviel er besaß oder wieviel ihm zukam, was erlaubt und was verboten war. Alles hatte seine Norm, sein bestimmtes Maß und Gewicht.«4
So sehr auch er verklärte und die goldene Zeit sicher nicht nur seiner k.u.k.-Monarchie beschwor, begriff er doch die Tiefe des Bruchs Jahre vor dem Beginn jener Systemauseinandersetzung zwischen Kapitalismus und Sozialismus in ihren jeweils konkreten Erscheinungsformen. Denn trotz...
Kategorien
Kategorien
Service
Info/Kontakt










